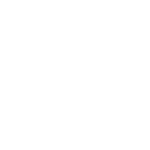Die Entwicklung des Kriegswesens im 15. Jahrhundert (unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz)
Die Schlachten des Mittelalters sind fast ausschließlich Reiter- d. h. Ritterschlachten. Nur in ganz wenigen Schlachten, bei
denen aber auch der Vorteil des Geländes eine ausschlaggebende Rolle spielte, so z.B. bei Courtray im Jahre 1302, wo die
flandrischen Handwerker das Ritterheer Philipp IV. von Frankreich überwanden, oder bei Bannockburn 1314, wo die Schotten ihre
Unabhängigkeit gegen das Heer Eduard II. von England errangen, siegten Fußsoldaten über Reiterheere. Die bekanntesten sind
wohl die Siege der Schweizer Bauern über die Ritterheere der Habsburger bei Morgarten 1315, Sempach 1386 und Näfels 1388.
Dies waren jedoch nur Einzelerscheinungen, die von den Zeitgenossen auch als solche aufgefaßt wurden, denn in der freien
Feldschlacht waren die Fußknechte deshalb nicht zu gebrauchen, weil sie noch nicht zu taktischen Körpern vereinigt waren.
Erst durch die blutigen Niederlagen, die die Reichsheere gegen die Hussiten erlitten, erkannte man die taktische Notwendigkeit
des Fußvolkes, und die hussitische Wagenburg wurde „adoptiert“.
Die Kriegsordnung der Ziska von Trocznow von 1423 gibt einen interessanten Einblick in die fanatisch, auf dem Glauben
basierende Ideenwelt der Hussiten. Die ersten sieben Absätze dieser Kriegsordnung beinhalten nur religiöse
Grundsatzerklärungen und bekräftigen das Sendungsbewußtsein, z. B.: „Und wer immer diese oben geschriebenen Stücke und Artikel
nicht halten, betätigen und erfüllen und nicht helfen wollte, sie zu verteidigen und zu verfechten, keinen solchen ohne
Ausnahme gedenken noch wollen wir unter uns und im Heere, mit Gottes Hilfe, und auch auf Burgen, in Vesten, in Städten, in
umfriedeten und offenen Städtchen, in Dörfern und auf Höfen, keinen Ort ausnehmend noch entschuldigend, sondern ausnahmslos
alle überall zu dieser guten Sache ermahnen, raten, antreiben und jagen, mit Hilfe unseres Herrn Gottes“.
Es werden in dieser Kriegsordnung aber auch bereits Bestimmungen über die Ordnung und das Losungswort erlassen: „Darauf dann
sollen sie Ihre Leute schichten oder ordnen, jede Rotte unter ihre Fahne, das Losungswort soll ausgegeben werden……“.
Weiters wird auch streng darauf geachtet, daß im Hussitischen Heer die Moral beachtet und über die Sünder jeglicher Art nach
dem Gesetz Gottes Gericht gehalten wird.
Die Parallelen zu späteren, religiös fundierten, fanatischen politischen Parteien und Kampfgemeinschaften wie z. B. den
Eisenseiten eines Fairfax und Cromwells im 17. Jahrhundert sind nicht zu übersehen.
Auf die Bestimmungen einer Kriegsordnung Hajeks von Hodetin aus dem Beginn des 15. Jahrhunderts über die Mühlen sei noch
hingewiesen und zwar deshalb, weil solche und ähnliche Verfügungen in den Kriegsordnungen des 15. Jahrhunderts aufscheinen.
„Was die Mühlen betrifft, befehlen wir, daß keine verbrannt, zerstört oder verdorben, noch welche Mühleisen weggenommen
werden, damit für die Bedürfnisse unserer Heere gemahlen werden könne. Wenn aber doch jemand etwas dagegen täte, dem wird ohne
Gnade die Hand abgehauen. Und auch sonst sollen in Höfen oder Bauernhütten, besonders im Freundesland, keine Schlösser, Ketten
oder anderes Eisen als Wagenradschienen oder Tornägel ab- oder herausgeschlagen und weggenommen werden und auch auf dem Felde
soll man von den Pflügen kein Eisen oder anderes Zugehör wegnehmen“.
Über die Hussiten und ihr Kriegswesen haben Max Jähns und Hans Delbrück ausführliche Untersuchungen angestellt.
Die Böhmen waren zunächst nicht imstande, es im freien Feld mit den deutschen Kriegsscharen König Sigismunds aufzunehmen, der
bis Prag vordrang und eine Belagerung dieser Stadt versuchte. Es kam zu mehreren Gefechten, in denen auch die Deutschen noch
mehrmals siegten, und er Krieg kam in ein gewisses Gleichgewicht. „Die Hussiten gewannen Zeit, sich im Kriege und durch den
Krieg selbst ihr eigenes und eigentümliches Kriegertum zu schaffen“.
Die Einbrüche in Deutschland beginnen erst im achten Jahr des Krieges 1427. „Die große Aufgabe der hussitischen Führer war,
die mit den zur Hand befindlichen Waffen, Spießen, Hellebarden, Äxten, Morgensternen, Flegeln ausgerüsteten Volksmänner fast
ohne Schutzwaffen, Helm, Panzer, Schild, gegen ansprengende Ritter standhaft zu machen“.
Dazu dient die Wagenburg, die zuerst wohl aus gewöhnlichen Bauernkarren bestand, später wurden die Wagen eigens zu diesem
Zweck konstruiert und mit Zusatzgeräten, Brettern, Ketten, Äxten, Schaufeln etc. ausgestattet. Wenn möglich, fuhren die in
einem Viereck aufgefahrenen Wagen, die Wagenburg, auf einer Anhöhe in Stellung, und dahinter standen die Verteidiger mit
Wurfgeschossen aller Art, auch schon Geschützen. Sollte nun eine solche Wagenburg gestürmt werden, mußten die Reiter
selbstverständlich absitzen und in ihrer schweren Rüstung den Hügel unter einem Geschoßhagel zu ersteigen versuchen. Sobald
sich aber Unordnung oder vielleicht auch nur Zögern bemerkbar machte, stürmte die bereitgehaltene Reserve der Hussiten mit den
blanken Waffen aus dem Ausfallstor heraus, den Angreifern zum Verderben. Die gesamte, einfache Taktik bestand darin, den
Angriff abzuwarten und im günstigsten Augenblick loszustürmen.
Es gibt aus dem 15. Jahrhundert zahlreiche Wagenburgordnungen, über die Jähns einen Überblick gegeben hat.
Die Schwäche der hussitischen Wagenburg-Taktik liegt in ihrer ausschließlich defensiven Anwendbarkeit. Trotz ihrer
Schwerfälligkeit und ihrer einseitigen Verwendbarkeit ist sie dennoch von großer Bedeutung, weil sie den Fernwaffen, auch
schon den neueren Fernwaffen, eine starke Wirksamkeit ermöglichte und ganz besonders dem gewöhnlichen Fußvolk mit der blanken
Waffe eine selbständige und schlachtentscheidende Verwendung vermittelte. So kam es zu den großen Niederlagen der deutschen
Reichsheere bei Aussig 1426, Mies 1427, Tauß 1431, und die Hussiten wurden der Schrecken ihrer Nachbarländer. Sie selbst sind
unbesiegt geblieben. Erst der innere Gegensatz zwischen Radikalen und Gemäßigten brach ihre Macht. „Am 30. Mai 1434 mußte das
radikale Hussitentum nach 15-jährigem unentschiedenen Kampf um die hussitische Hegemonie seine bloße Existenz verteidigen:
Prokop ‘der Große’ mit den Orebiten, Prokop ‘der Kleine’ mit den Taboriten und die mit ihnen verbündete Prager Neustadt
erlitten bei Lipany in Nordostböhmen eine vernichtende Niederlage gegenüber den Altstädtern und der Mehrzahl der Barone“.
Als Soldbanden, die bald in dieses, bald in jenes Herren Dienst traten, haben sich die Reste der Taboriten noch lange das
ganze Jahrhundert hindurch erhalten und fortgepflanzt.
„Von den drei Elementen der Kriegerschaft, die uns im Mittelalter begegnen, Volksaufgebot, Vasallentum und Söldnertum, hat
sich das dritte als das stärkste erwiesen, ist von Generation zu Generation gewachsen und nähert sich der Alleinherrschaft“.
In Italien bildeten die Söldner meist die Gefolgschaft eines Hauptmannes, eines Condottieres (von conducere = werben, dingen,
mieten), der die einzelnen in seinen Dienst genommen hatte. Diese Bandenführer gehen von dem Dienst eines Landes oder Fürsten
in den eines anderen und treiben eine vollkommen eigenständige und eigennützige Politik. Sie steigen oft zu Fürsten der Städte
auf, denen sie vorher dienten, so z. B. wird Franz Sforza 1450 Herzog von Mailand, aber auch die Scala in Verona, die Conzaga
in Mantua, die Este in Ferrara und die Malatesta in Rimini erreichen als ursprüngliche Söldnerführer die soziale Spitze.
Fast noch mehr als Italien litt Frankreich unter den Söldnerbanden, die im hundertjährigen Krieg von beiden Seiten angeworben
worden waren und nun vor allem nach Beendigung des Krieges als Räuberbanden das Land bedrückten. Nach ihrem Führer, dem Grafen
von Armagnac, benannt, „waren sie ein wilder Söldnerhaufen, bestehend aus Franzosen, Bretonen, Cascognern, Lombarden,
Spaniern, Schotten und Engländern, zumeist berittenes Söldnervolk, 40.000 Köpfe, davon 20.000 kampffähiges Volk“.
„Um Die Banden loszuwerden, schufen die französischen Könige die im modernen Sinne stehende Armee…. Der Reichstag bewilligte
die nötigen Steuern, um eine stehende Truppe von 15 Kompagnien zu 100 Lanzen zu sechs Mann, also 9000 Reiter im ganzen, zu
unterhalten…. In die neuen Ordonnanz-Kompagnien nahm man die besten Elemente der bisherigen Banden auf und überwand mit
ihrer Hilfe die übrigen, die gezwungen wurden, auseinander zu gehen“.
Ihre Reste schickte man nach Lothringen, ins Elsaß, in die Schweiz, wo es zu der berühmten Schlacht von St. Jakob bei Basel
(1444) kam, wo die Armagnaken zwar siegten, durch die heldenhafte Selbstaufopferung der Schweizer Vorhut aber so schwere
Verluste erlitten, daß sie sich wieder zurückzogen.
Durch ihre Siege über den Herzog Karl den Kühnen von Burgund (1467-1477) begründeten die Schweizer ihren Ruhm als Fußkämpfer
und wurden die begehrtesten Söldner der nächsten Jahrzehnte. Kaiser Friedrich III., König Ludwig XI. von Frankreich, die
Schweizer und Herzog Rene von Lothringen schlossen ein Bündnis, da sich der länderhungrige Herzog Karl des letzteren Landes
bemächtigen wollte. Nachdem er von den Schweizern am 1. März 1476 bei Grandson und am 22. Juni 1476 bei Murten schmähliche
Niederlagen erlitten hatte, kam es am 5. Jänner 1477 zur Schlacht bei Nancy, auf die wegen ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung
näher eingegangen werden soll.
Nancy, die Hauptstadt von Lothringen, wurde von Karl belagert. Das Entsatzheer unter Herzog Rene war seinem Gegner zahlenmäßig
weit überlegen. Dank der Hilfe König Ludwigs XI. von Frankreich standen ihm außer seinen lothringischen Truppen noch 12.000
Schweizer zur Verfügung.
„Noch immer lag Karl vor Nancy, wo der fürchterlichste Hunger wütete. Sein Heer bestand aus den Ordonnanzcompagnien,
englischen Bogenschützen, flandrischen Lehentruppen und Luxenburgern. Krankheit und Meuterei hatten es so geschwächt, daß kaum
10.000 mehr vorhanden waren, von denen nur der fünfte Teil als wirklich tüchtig gelten konnte…. Am Abend des 4. Januar ging
Nikolaus von Monfort, Graf von Campobasso, mit 180 lombardinischen Lanzen zu Lothringen über“.
Am Morgen des 5. Januar 1477 kam es zur Schlacht.
Karl stellte seine Truppen an einer Stelle auf, wo zwischen der Meurthe links und einem Walde rechts, Front nach Süden, nur
ein mäßig breiter Zugang war; links und rechts standen die Reiter.
Die Bundesgenossen beschlossen, die Taktik der Schlacht von Murten wieder anzuwenden und die von Wäldern gedeckte Stellung des
Feindes zu umgehen. Der Plan gelingt, und als sie fast im Rücken der Burgunder hervorbrechen, kommt es sofort zur Panik. Was
nicht flieht, wird niedergehauen.
„Die Kriegsbeute war unermeßlich. Das burgundische Lager wurde von den Lothringern, Elsässern und Schweizern geplündert. Was
man nicht fortschleppen konnte, wurde in Brand gesteckt… Zwei Tage nach der Schlacht entdeckte man den Leichnam des letzten
der großen Herzöge nackt und entstellt im Schlamm des Teiches von Saint-Jean, auf dessen Eisdecke gekämpft worden war“.
Die Folgen dieser Schlacht waren ganz außerordentlich. Die Schweizer, die zum ersten Mal außerhalb ihres Landes einen
entscheidenden Sieg errungen hatten, wurden die umworbenen und gefürchteten Krieger und Söldner, und ein Mann, Maximilian,
trat durch seine Heirat mit Maria, der Erbin von Burgund, am 19. August 1477, ins Rampenlicht der Geschichte. Dadurch wurde
nicht nur der Gegensatz zwischen den beiden christlichen Großmächten Europas, Frankreich und Habsburg, durch Jahrhunderte
begründet, sondern Maximilian war auch Organisator des neuen Kriegsvolkes, der Infanterie.
Wieso war es überhaupt möglich, daß die kleine Eidgenossenschaft, die in der Mitte Europas lag und deren politische Struktur
von den sie umgebenden feudalen Monarchen mit äußerstem Argwohn beobachtet wurde, in den letzten Jahrzehnten des 15.
Jahrhunderts und den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts eine so überragende Stellung einnehmen konnte?
„Die Kriegskraft der Schweizer hatte die Teilnahme jedes Einzelnen am politischen Leben zur Voraussetzung; das trotzige
Selbstbewußtsein, das jeden einzelnen Knecht beseelte, gab den Unternehmungen des Bundes die unwiderstehliche Wucht“.
Mit der Schlacht von Nancy trat dieses Massenkriegertum zum ersten Male über seine Grenzen hinaus und siegte, ohne daß ihm
diesmal das vertreute Gelände seiner Berge zu Hilfe gekommen war. Die Burgunderkriege waren ja eine Zäsur in der Entwicklung
der Eidgenossenschaft nach innen wie nach außen. Die gezeigte militärische Schlagkraft und Stärke bewirkten, daß sie ein
gesuchter Partner für die europäischen Mächte wurde, und in den folgenden Jahren wurden Verträge mit Mailand, Savoyen,
Österreich und dem Papst abgeschlossen. Es trat eine Verstrickung mit der Politik der benachbarten Staaten ein, und die
Eidgenossen muteten sich Aufgaben zu, denen ihr System und ihre Struktur auf längere Sicht nicht gewachsen waren. Im gleichen
Zeitraum fiel auch, im Gegensatz zu ihrem Staatswesen, in den benachbarten Fürstentümern die Entscheidung für die nationale
Einheit.
In erster Linie verlangten diese mit der Schweiz verbündeten Staaten militärische Hilfe, also Söldner. Dadurch lernten auch
die anderen Völker die Voraussetzungen und Gründe kennen, auf denen die Überlegenheit der Eidgenossen beruhte, und es
entstanden die Vorläufer der europäischen Infanterie.
Einen hervorragenden Beitrag über die Kriegsorganisation der Eidgenossen hat Walter Schaufelberger gleistet. In dieser Arbeit
untersucht er ausführlich die Kriegsvorbereitung sowie die Kriegsführung. Wenden wir uns zunächst der Bewaffnung zu. Die
eigentlichen Standartwaffen sind Halbarte und Spieß, daneben aber auch Schlagwaffen wie Hammer, Axt und Beil, sowie
Griffwaffen (Schlachtschwert und Bidenhänder). Dazu kommen noch Kurzschwerter aller Art, sowie Dolche und Messer, während der
bekannte und berühmte Morgenstern in den Quellen des 15. Jahrhunderts nirgends vorkommt. Als Ergänzung dienten noch mehr oder
weniger vollständige Harnische und manchmal auch ein Eisenhut, der Hauptharnisch. Verkauf, Vertauschung und Verschenkung der
Waffen war verboten, ebenso das Verpfänden. Sogar Witwen und Waisen hatten die Wehre je nach ihrem Vermögen zu unterhalten.
Weiters wurden Armbrust- und Büchsenschützen eingesetzt. Die Reiterei und Geschütze spielten nur eine sehr untergeordnete
Rolle, was dann im nächsten Jahrhundert zum Niedergang der eidgenössischen Macht wesentlich beitragen sollte.
„Die Schlachtordnung der Eidgenossen war die denkbar einfachste. Sie fochten in festgeschlossenen Gevierthaufen, die
ebensoviel Mann in der Front wie in der Flanke zählten und also nach allen Seiten gleich stark waren. Auch ein sehr großer
Gevierthaufen, etwa 10.000 Mann, hat noch eine bedeutende Beweglichkeit, weil die Front mit 100 Mann ja noch sehr schmal ist“.
Wird nun so ein Haufen von Reitern angegriffen, so runden sich seine Ecken beim Stillstand in der Verteidigung mehr oder
weniger ab, die Spieße werden vorgestreckt und es komm zum „Igel“. Die äußeren Glieder und Rotten waren mit bis zu 20 Fuß
langen Spießen ausgestattet, die wegen ihrer Schwere mit beiden Händen geführt werden mußten. Ebenso wurden die Hellebarden,
die von den inneren Gliedern und Rotten der Knechte getragen wurden, mit beiden Händen geführt. Die Hellebarden treten aber
erst in Tätigkeit, wenn der Feind dem Druck bereits nachgegeben hat und weicht. Dann löste sich der Haufen auf, und es „begann
das Nachhauen. Die Hellebarde durchschlägt nun die Rüstung der fliehenden Ritter und der Haken reißt sie vom Pferde“.
Die Kriegsführung dieser Zeit war äußerst grausam, und in den Kriegsordnungen wurde ausdrücklich verlangt, daß keine
Gefangenen gemacht werden dürfen. „Jedes Ort soll die Seinen schwören lassen, wenn wir hinfür ein Gefecht und Streit tun,
keine Gefangenen zu machen, sondern alles tot zu schlagen ‘als unser fromen Altvordern allweg brucht haben’“. Auch die Flucht
aus der Ordnung wurde mit dem Tode bestraft. So heißt es in der Eidgenössischen Kriegsordnung von 1476: „Niemand soll fliehen
noch eine Flucht machen. Welcher solchs übersehe, den selbigen solt der nechst, so ferr er möcht, vom Leben zum Tod bringen,
ihn damit gebüsst und kein Straff verdienet haben. Wann aber ein solcher Flüchtiger entrunne, an dem sollt (wurd er ergriffen)
als ab einem meineydigen Bösewicht gerichtet werden“. Als besonders krasses Beispiel für Vorgänge aus dieser Zeit sei eine
Bestimmung aus der Zürcher Kriegsordnung von 1444 erwähnt, wonach es verboten wird, den toten Feinden das Herz
herauszuschneiden, den Bauch aufzuschlitzen oder sonstwie die Leichname zu schänden.
Grundlage des Schweizer Wehrwesens war die allgemeine Wehrpflicht, der jeder Mann vom 16. Bis zum 60. Lebensjahr unterworfen
war. Wie diese theoretische Forderung in der Praxis gehandhabt wurde, wird weiter unten noch behandelt werden. Es müßte daher
die Ausbildung und Schulung bereits im Knabenalter durchgeführt worden sein, wovon jedoch in den Quellen nirgends ein Hinweis
aufscheint. Eine Einzelausbildung und gemeinsame militärische Schulung war gar nicht nötig, da die jungen Schweizer in das
rauhe Kriegshandwerk von selbst hineinwuchsen, von dem sie wußten, daß es eben zu ihrem Leben gehört. „Mars selbst brachte
ihnen das Handwerk bei. Statt ihn zu erlernen, erlebten sie den Krieg. Das haben ihre entsetzten Feinde immer wieder zu spüren
bekommen. Auf Schützenfesten übten sich die Jungen und Burschen im Schießen, und auf Spielwiesen stärkten sie ihre
körperlichen Kräfte und ihre Gewandtheit im Springen, Laufen, Stoßen und Ringen. Auch in Fechtschulen fand sich Gelegenheit,
die Waffentüchtigkeit zu vervollkommnen. „Das eigentliche Zentrum, wo sich sowohl Kriegssitten, als auch militärische
Virtuosität in spontaner naturgegebener Erneuerung erhielten, waren die Männerbünde, denen in hohem Maße ein jugendhafter,
knabenschaftlicher Charakter innewohnte“.
Ihre Mitglieder waren daher durch stetige Wettkämpfe und dauernden Kampf so geschult, daß sie auch ohne eigentliche Führung in
der Schlacht siegen konnten. Die Glieder dieser Verbände hießen „freiheiten, freiharste, freiheitsbuben, freie knechte, usw.“.
Bei der Taktik im Verband war die wuchtige Schwere des Gewalthaufens das hervorstechende Kampfelement. Daher war für die
massive Kampfführung nur die Aufrechterhaltung der Tuchfühlung mit dem Nebenmann wichtig, die Bildung eines eng
zusammengedrängten Körpers, der lawinengleich gegen den Feind stürzt. Die spielerischen Scheinkämpfe in den Männerbünden waren
daher zur Gewöhnung an die militärischen Erfordernisse völlig ausreichend.
Es wurde die Methode ausgebildet, das Heer, ganz unabhängig von der Stärke, in drei Haufen zu ordnen. Diese standen nun nicht
neben- oder unmittelbar hintereinander, wo sie im Laufe des Kampfes sich gegenseitig behindern konnten, sondern sie
marschierten staffelförmig auf. Hierauf wurde nicht gleichzeitig losgeschlagen, sondern die einzelnen Haufen griffen
nacheinander an. „So behielt der Gewalthaufen und besonders die Nachhut, nachdem die Schlacht bereits entbrannt war, noch die
Freiheit, ihre Bewegungen dem Gang der Ereignisse anzupassen.“
Wie aber wurde damals die Mannschaft in der Schweiz alarmiert, wenn ein feindlicher Angriff drohte? „Stand ein feindlicher
Einfall unmittelbar bevor oder war er bereits geschehen, dann erging der Landsturm. So bezeichnete man noch im 15. Jahrhundert
den Alarmvorgang, später dann auch die Mannschaft, der sie auf die Beine brachte.“
Verschiedene Systeme wurden dabei angewendet, zuerst wurden Boten ausgesendet, dann Rauch- und Feuersignale, was jedoch meist
ungenügend war. Man griff daher zur akustischen Form der Alarmierung, zu Büchsenschüssen und dem Läuten der Sturmglocken.
Daneben dienten aber auch Trompeten und Trommeln als primitivste Lärminstrumente zur Nachrichtenübermittlung. Wenn noch Zeit
bis zum Ausrücken blieb, wurde das Banner oder ein Fähnlein am Rathaus gehißt zum Zeichen, daß Krieg beschlossen wurde und die
Mannschaft auszurücken habe.
Wie erwähnt, bestand bei den Schweizern die allgemeine Wehrpflicht, die urgermanische Kriegsverfassung des allgemeinen
Landesaufgebotes. Sie bestand jedoch eher im Prinzip als in der tatsächlichen Handhabung. Es gab selbst bei großer Gefahr
immer wieder Ausnahmen, nicht nur wegen Alter und Krankheit. Wer aber nicht persönlich ins Feld zog oder gerade auf Reisen
war, mußte sich durch einen Ersatzmann vertreten lassen, den „Söldner“. Vor allem die finanzstarken Stadtbürger machten von
dieser Möglichkeit Gebrauch, wobei die von ihnen bezahlten Söldner besonders aus Mitgliedern der schon erwähnten Knaben- und
Jungmännerbünde bestanden.
Die auszuhebende Truppenanzahl wurde durch die Tagsatzung oder die Ortsregierung festgelegt, die Aufteilung selbst erfolgte
durch die Ortsbehörden, Ämter, Vogteien, in den Städten in weitgehendem Maße durch die Zünfte. In eigenen Aufstellungen wurde
die Zahl der Wehrfähigen festgestellt und dann beurkundet, wer tatsächlich zum Heeresdienst einzuziehen sei. Auch die
Sammelplätze wurden im voraus bestimmt.
Bei der Ritterschaft selbst gab es ursprünglich kein Offizierskorps, da der Ritter ein Einzelkämpfer war und der Einfluß des
militärischen Führers im Gefecht sehr gering war. Es fehlte ihm ja auch die Übersicht.
Ursprünglich waren auch bei den Eidgenossen in den Kämpfen der Urkantone die politischen Führer auch die militärischen. Dies
ließ sich jedoch bei der Komplizierung des Staats- und Heerwesens und der Vergrößerung des Staates zu einem umfassenden
Staatenbund mit divergierenden Interessen nicht mehr beibehalten. So mußten militärische Vorgesetzte bestellt werden, die
Hauptleute. Bereits in der ältesten Kriegsordnung der Schweiz, dem Sempacherbrief vom 10. Juli 1393, wird von den Knechten
Gehorsam gegen die Hauptleute verlangt „under die er gehöret“. Hauptmann wird aber jeder genannt, ob die Chroniken damit den
Kommandanten eines Auszuges von 2000 Mann meinen oder das Haupt einer zusätzlichen Verstärkung von 50 Knechten. Die schwierige
Stellung des Hauptmannes zwischen der ihn bestellenden Obrigkeit und den trotzigen, selbstbewußten Knechten hat Albert
Sennhauser in seiner Dissertation 1952 eingehend durchleuchtet. Aus der Tatsache, daß die Hauptleute einen Eid schwören
mußten, ist ihre rechtliche Unterordnung ersichtlich, und in den Artikeln ist ihre Kompetenz genau festgelegt. Bei
Gehorsamsverweigerung war oft eine Resignation der Führer festzustellen, die sich darauf beschränkten, dem Rat daheim die
Vorfälle zu melden, der dann für Ordnung sorgen sollte. Denn war ein Krieger schlechter Laune, so konnte ihm der
fadenscheinigste Vorwand genügen, um aus dem Feld zu Laufen. Der Befehlshaber befand sich stets zwischen dem Gesetz, das die
Obrigkeit verkörperte und auf das er seinen Eid geleistet hatte, und der Schar seiner Krieger, die nur schwer aufgrund der
Buchstaben ihrer Verpflichtung mit Erfolg geführt werden konnten. Bei Beginn des Krieges leisteten die Knechte einen Eid des
Gehorsams gegenüber ihrem Hauptmann, manchmal auch auf das Banner. Theoretisch herrschte eine fast uneingeschränkte
Strafgewalt der eidgenössischen Hauptleute, die aber im auffallenden Gegensatz zur Zurückhaltung steht, mit der sie von den
Führern gehandhabt wurde. Vor dem Kampf verlangten die Knechte oft, den Kampfplan zu erfahren, und die Hauptleute benützten
die Gelegenheit bei der Aufstellung, um ihnen diesen zu erläutern, mit ihnen zu reden und ihre Kampflust anzustacheln. „Die
Hauptleute mußten oft drastische Mittel finden, um die Knechte zum Gehorsam zu bringen, etwa wenn sie, um die Leute von der
großen Beute bei Hèricourt wegzubringen, den Weinfässern den Boden ausschlagen ließen.“. Besondere Gradabzeichen für die
Hauptleute hat es nicht gegeben. Sie zeichneten sich nur durch prächtigere Kleidung und feinere Waffen vor den gewöhnlichen
Kriegern aus. Auch scheint als Vorläufer der Feldbinde ein rotes Band von den Befehlshabern getragen worden zu sein.
Neben dem Hauptmann finden wir bald auch den Fähnrich, der einen besonderen Eid zu schwören hatte und der die Aufsicht über
das Banner hatte, das als besonderes Kampf- und Ehrenzeichen galt. Gegen das Ende des 15. Jahrhunderts finden wir auch bereits
den Lieutenant (angeführt als Lüttiner) und einige Weibel und Furiere. Weiters erscheinen Spielleute, Schreiber und Priester.
Die Räte, die in den Schweizer Heeren aufscheinen, waren Vertreter der zivilen Obrigkeit und die politischen Berater der
militärischen Führer. Die Einsetzung der Chargen aller Grade erfolgte – entgegen dem späteren Gebrauch bei den Landsknechten –
durch die Obrigkeit, gegebenenfalls auch durch den Werbeherrn.
Es ist charakteristisch für den Kriegsdienst der Schweizer – ganz im Gegensatz zu den späteren Landsknechten -, daß sich die
Verbindung zur Heimat nie aufgelöst hat. Die Söldner haben sich stets als Schweizer gefühlt, und die staatliche Aufsicht über
sie blieb immer erhalten. Es wurde nach ihrer Rückkehr von ihnen Rechenschaft über ihr Verhalten auch in fremden Diensten
gefordert. Die Eidgenossenschaft hat sich im Notfall auch ihrer Staatsangehörigen in der Fremde angenommen und deren
Interessen, etwa wegen rückständiger Soldzahlungen, vertreten. „Auf eben dem Tag soll man ratschlagen und beschließen auf das
Anbringen Hansen Meyenbergs und Hansen Ungelters von Zug, wie sie und ihre Gesellen Söldner der Venediger gewesen, und,
nachdem sie ihre Dienstzeit vollendet, von diesen um den Sold betrogen worden seien, weswegen sie bitten, die Venediger, die
noch immer in der Eidgenossenschaft wandeln, während keine Eidgenossen nach Venedig gehen dürfen, darum angreifen zu dürfen.“
Die Bewohner der Schweiz waren in erster Linie Hirten und Bauern, die ihrem kargen Boden nur mit Mühe das Lebensnotwendigste
abrangen. Die Übervölkerung, die Abenteuerlust, das Locken der Beute und die reine Freude am Kriegertum bildeten die Grundlage
für den Söldnerdienst, das Reislaufen im Dienste fremder Staaten und Fürsten. Natürlich trugen diese Söldner nicht wenig dazu
bei, die Kriegserfahrung unter den Schweizern auch in den Zeiten zu nähren, da daheim Friede war. Ferner trugen diese Söldner
die Kenntnis von den Besonderheiten ihrer Kriegsführung schon damals in die benachbarten Länder. Für die Anwerbung mußte
selbstverständlich die Genehmigung der eidgenössischen Obrigkeit eingeholt werden, und es kommt immer wieder zu drastischen
Strafandrohungen gegen unbefugte Reisläufer.
Im Jahre 1449 ersuchte der deutsche Städtebund in seinem Krieg mit dem Markgrafen Albrecht Achilles von Ansbach, dem späteren
Kurfürsten von Brandenburg, Luzern um die Erlaubnis, Schweizer Söldner anwerben zu dürfen, was auch genehmigt wurde. Der
Vertrag, den der Hauptmann Hans Müller mit diesen abschloß, umfaßt nachstehende Bestimmungen:
Der monatliche Sold von 5 rheinischen Gulden wird vom Ausmarsch an bezahlt. Ein angefangener Monat wird als ganzer gezählt.
Wenn von den Städten gekündigt wird, so erhalten die Knechte zur Unterstützung ihrer Heimreise einen Sold für 14 Tage dazu.
Wenn aber die Eidgenossen kündigen gibt es nur eine Zulage von 8 Tagen. In Feldzügen werden sie kostenlos verpflegt und haben
auch Anteil an der Beute. Auch Verwundete werden verpflegt und bekommen ihren Sold. Die Knechte sind zum Kampf verpflichtet,
doch wird ihnen versprochen, sie nicht zu trennen. Bei gegenseitiger Zufriedenheit erhalten sie bei einer freundlichen
Heimfahrt eine Gratifikation. Als Handgeld werden 2 rheinische Gulden gegeben. Die Knechte müssen folgende Artikel beschwören:
Sie dürfen keinen frevelnden Schwur bei Gott, seiner lieben Mutter, der Jungfrau Maria, und den Heiligen leisten.
Sie dürfen kein Gotteshaus oder Kirche anzünden oder berauben, keine geistliche Person, Priester, Frauen, Kinder berauben oder
mißhandeln, es sei denn, daß diese sie angreifen oder schreien.
Keiner soll ‘keine eigene Frau mit sich führen’, auch nicht spielen.
Freunde sollen sie nicht berauben oder mißhandeln; in Herbergen und bei andern Leuten sollen sie sich züchtig und freundlich
halten, auch die Zeche bezahlen.
Alten Haß und Feindschaft dürfen sie nicht an einander rächen.
Streitigkeiten sind vor die Hauptleute zu bringen.
Sie sollen gütlich und friedlich mit einander leben. Streitigkeiten und Aufläufe werden von den Hauptleuten mit Bußen
bestraft.
Wer diese Artikel nicht beschwört, soll heimziehen.
Die Voraussetzungen für die Verwaltung des Heeres und den Nachschub waren in der Schweiz insofern günstig, da das gesamte
Staatsgebiet sehr klein war. Besonders bis zu den Burgunderkriegen konnte die nur für kurze Zeit aufgebotene Kriegsmacht
unschwer aus dem Lande verpflegt werden. Schwerer wurde es erst, als die Eidgenossen sich auf kriegerische Unternehmungen
außerhalb ihrer Landesgrenzen einließen. Es galt das Prinzip, daß die Stellungsbezirke ihre Krieger für die Dauer der
Dienstleistung auch zu versorgen hatten. Mit Ausnahme vielleicht von Obst und Gemüse mußten wohl alle Nahrungsmittel
nachgeschoben werden, wobei die Milchprodukte dabei einen bevorzugten Platz einnahmen. Es gab selbstverständlich schon einen
Troß, der aus Wagen und Saumpferden bestand, wobei bei den meisten Kriegszügen 300 Wagen und Karren durchaus keine Seltenheit
bedeuteten. Da aber die Fuhrleute Privatunternehmer waren, die ihren eigenen Vorteil im Auge hatten, war das Nachschub- und
Versorgungsproblem äußerst prekär. Raub, Brand und Plünderung der Bevölkerung waren daher an der Tagesordnung, trotz aller
Bemühungen der Obrigkeit. „Die Anstrengungen des Regimentes zur Versorgung der Kriegsleute sind, alles in allem genommen,
durchaus bemerkenswert. Daß sie die Zustände noch nicht wesentlich verbesserten, darf den Kriegsherren kaum angekreidet
werden. Die ordentlichen Kräfte reichten einfach noch nicht aus und die Übel saßen zu tief. So sprachen die Knechte das letzte
Wort“.
Die Anstrengungen der Schweiz, sich zu einer Großmacht zu entwickeln, sind mit der Schlacht bei Marignano, in der sie 1515 von
König Franz I. von Frankreich besiegt wurde und ihren Einfluß im Herzogtum Mailand verlor, abgeschlossen. Die eidgenössische
Politik und Kriegsmacht trat seitdem fast ausschließlich in den Dienst Frankreichs. Die Schweizer Krieger wurden seitdem mit
den Truppen anderer Länder gleichwertig und gleichartig. Sie versäumten es auch, die beiden anderen Waffengattungen der
Kavallerie und der Artillerie zeitgemäß zu entwickeln und mit ihrer Infanterie taktisch nach den neuen Erkenntnissen und
Erfordernissen zu verbinden. Dies erklärt sich wohl daraus, daß die Eidgenossenschaft schon aufgrund ihrer staatlichen
Struktur und der finanziellen Lage nicht imstande war, eine zeitgenössische Artillerie aufzustellen und auszubauen. Es hätte
dafür einer zentralen Leitung und größerer Geldmittel bedurft, wie sie jetzt nur den zentralistischen Fürstenstaaten zu Gebote
standen. Das Gleiche gilt für die Kavallerie, bei der auch noch völlig die ritterliche Tradition des Reiterkämpfers fehlte.
Auch war das gebirgige Gelände des Staates für diese Kampfart unbrauchbar, und es wurde daher auch die Pferdezucht, die
Voraussetzung dafür, nicht gepflegt. Warum auch hätten sie diese beiden Waffengattungen ausbauen sollen? Sie fühlten sich in
ihren Bergen vor Angreifern sicher und vertrauten der Krone Frankreichs, die mit den Schweizer Fußsoldaten auch zu ihrem
Schutz ihre Schlachten weit in der Fremde schlug.
„Nur die Schöpfung der Infanterie, die allen Ländern zum Muster wurde, ist die weltgeschichtliche Bedeutung der Schweiz“. Und
diese Infanterie, die als Landsknechte und spanische Triceros in den nächsten Jahrzehnten bei Bicocca, Pavia und Mühlberg
schlachtenentscheidend wurde, bestimmte das Schicksal von Fürsten, Staaten und Völkern.